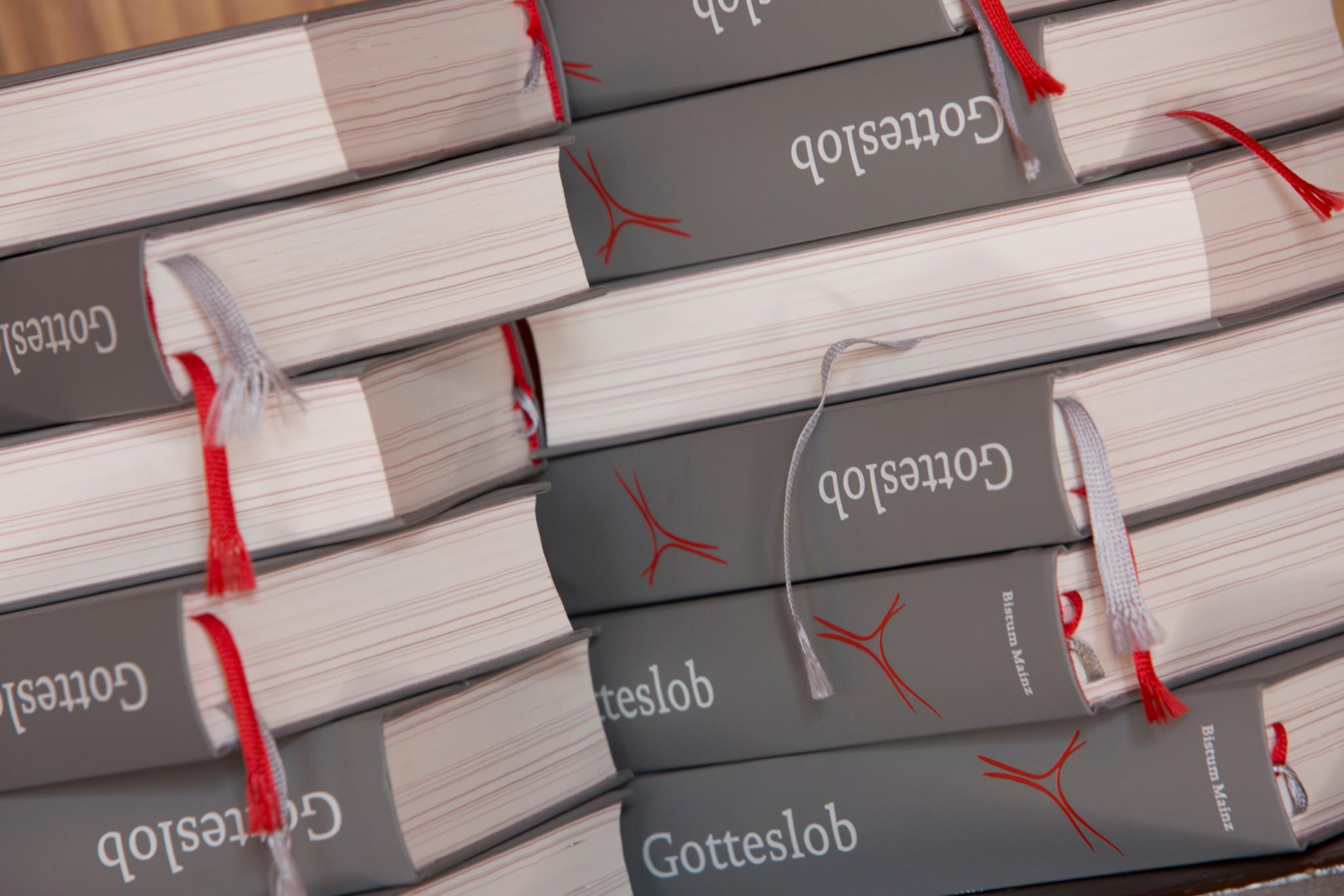Text: Jochen Klepper 1938
Melodie: Johannes Petzold 1939
Text
- Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern! So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern! Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.
- Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt.
- Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf! Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah.
- Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her.
- Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.
Für die Entstehung dieses etwas „düsteren“ Textes ist es wichtig die Lebensumstände von Jochen Klepper einmal zu betrachten. Klepper war als Schriftsteller gefragt und hatte mit dem Roman „Der Vater“ über Friedrich Wilhelm I. auch einen kommerziellen Erfolg erzielt. Er wurde wegen seiner jüdischen Familie von den Nationalsozialisten verfolgt, alle Fluchtversuche sind gescheitert und er starb 1942 in Auschwitz im Alter von 39 Jahren.
Das Lied verfasste Jochen Klepper am 18.12.1937, und es erschien als Weihnachtslied im Jahr 1938 in einem Gedichtband. Es charakterisiert seine Zeit als eine in nächtlichem Dunkel befindliche, der wohl der anbrechende Tag folgt, welcher auch durch den dreifach erwähnten Morgenstern gekennzeichnet wird und zu dessen Lobgesang Strophe 1 aufruft. Gleichwohl bleibt der Ton düster, „Angst und Pein“ werden „beschienen“, nicht beseitigt, und von einer Sonne oder gar Erlösung ist nicht die Rede. Hier scheint Klepper eine Vorahnung über die schlimme Zeit, welche Deutschland und ihm ganz persönlich bevorstand, verarbeitet zu haben. Trotz aller düsteren Vorahnungen beschreibt er aber, tief in seinem Glauben an Gott verwurzelt, die Hoffnung auf die „Erlösung“.
Der Text verarbeitet diverse Bibelzitate, sowohl aus dem alten wie auch aus dem neuen Testament. Hervorzuheben sind die Zitate aus Römer 13,12 in der ersten Strophe und 1.Kön 8,12 in der fünften Strophe.
Melodie
Die ernste Melodie wurde von Johannes Petzold, einem Kirchenmusiker, Lehrer und Komponist, 1939 komponiert. Ursprünglich in c-Moll mit phrygischen Wendungen komponiert, steht das Lied im Gotteslob heute einen halben Ton tiefer. Der ernste Gestus der Melodie entspricht dem Text. Ein Aufleuchten bis zur Dezime an der Textstelle „der stimme froh mit ein“ (1.Str.) unterbricht den schwebenden, gedämpften und ruhigen Charakter. Der zwischen zwei Halben und drei Halben wechselnde Rhythmus unterstreicht den ruhigen und schwebenden Charakter.
Liedeinführung
Für die Einstudierung mit der Gemeinde empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen in zwei Abschnitten. Zunächst ist es wichtig kurz auf den Text einzugehen, um so ein Textverständnis zu schaffen und den textlichen Gehalt des Liedes bewusst zu machen.
Danach sollte man sich der Melodie zuwenden. Die Melodie ist getragen und gut zu singen, hat aber in ihrer Linienführung anspruchsvollere Passagen. Durch die Einteilung des Liedes in einzelne Phrasen, kann die Melodie durch Vorsingen und Nachsingen relativ schnell eingeübt werden.
Liturgische Verwendung
Liturgisch eignet sich das Lied besonders für die Adventssonntage, hier insbesondere für den Sonntag zum ersten Advent auf Grund der dem Text zu Grunde liegenden Sonntagsepistel aus dem Römerbrief Röm 13,11-14.
Da in dem Lied die Erwartung des kommenden Lichts zum Ausdruck gebracht wird, kann es aber auch gut an den anderen Adventssonntagen eingesetzt werden.